Rezensiert von Beatrice Dernbach
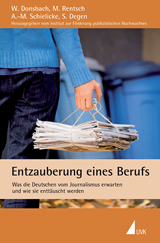

Erkenntnisse über das Bild des Publikums von Journalisten beschränken sich auf nackte Daten zu Ansehen und Glaubwürdigkeit, wie sie das Institut für Demoskopie in Allensbach regelmäßig ermittelt.1 Insofern lohnt eine Beschäftigung mit der Dresdner Untersuchung. Deren Ausgangspunkt sind Beobachtungen über Medien und Journalismus (das wird nicht explizit unterschieden), die plakativ und verkürzt beschrieben werden: Säkularisierung und Trivialisierung, Medienskandale, Kommerzialisierung, Negativismus und Verlust an professioneller Identität sind die Keywords. Die Autoren benennen es nicht, aber offensichtlich skizzieren sie diese aktuellen Tendenzen vor dem Hintergrund eines normativen Idealtypus von Journalismus: Der sei konstituierend für die Demokratie. Journalisten sollten die Bevölkerung repräsentieren, die öffentliche Meinung spiegeln und Journalismus wiederum über ihre Tätigkeit legitimieren. Die Forscher sprechen, in Anlehnung an den Begriff der ‘Politikverdrossenheit’ und im Rückgriff auf amerikanische Kollegen, von einer ‘Medienskepsis’ oder ‘Medienverdrossenheit’.
Das zentrale Interesse der Untersuchung liegt darin, Ansehen und Vertrauen der Bürger in Journalisten zu messen. Ausgangssituation und Fragestellung sind klar und flugs auf 35 Seiten formuliert, wobei diese im Kern aus Studien im Umfeld des Mainzer Instituts und aus amerikanischen Quellen gespeist werden. Mancher deutschsprachige, grundlagenwissenschaftliche Ansatz, wie er beispielsweise zum Thema Vertrauen von Matthias Kohring (2004) vorgelegt worden ist, wird kaum oder gar nicht wahrgenommen, ausgewertet oder im empirischen Teil operationalisiert. Es folgen zwölf Seiten zum Methodischen und ab Seite 61 startet die Darstellung der Ergebnisse. Möglicherweise ist dies ein Zugeständnis an den Leser, der weder Zeit noch Lust hat, sich damit zu beschäftigen, ob nicht aus der theoretischen Analyse heraus Thesen, Indikatoren und Kategorien generiert werden müssten, damit am Ende tatsächlich das gemessen wird, was am Anfang zu messen vorgegeben worden war. So wird als selbsterklärend gesetzt, dass Vertrauen und Wertschätzung die zentralen abhängigen Variablen sind und dass Einstellungen und Wahrnehmungen der Rezipienten gefunden werden sollen, “die einen Einfluss auf das Vertrauen und die Wertschätzung haben können” (49). Diese unabhängigen Variablen werden definiert als Merkmale der Rezipienten, der Journalisten und der journalistischen Produkte. Wer sich an dieser Stelle im Kreis gedreht fühlt, muss sich selbst entschleunigen. Im Buch jedenfalls findet er keine Haltegriffe, beispielsweise in Form einer ausführlichen Erklärung, weshalb ausgerechnet die ausgewählten Fragenkomplexe Antworten erbringen sollen. Aber schließlich ist für die Projektgruppe klar: Bei der Entwicklung von Fragebögen kann man “auf vorangegangenen Arbeiten aufbauen und muss nicht in jedem einzelnen Fall das Rad neu erfinden” (47). (Angesichts dieser Forschungsökonomie ist mit Spannung eine weitere Studie aus dem Dresdner Institut zu erwarten, die derzeit mit demselben Instrumentarium die Gruppe der Journalisten-Ausbilder untersucht.)
Die 1054 befragten Bürger wurden in zwei Gruppen mit jeweils 38 Fragen konfrontiert. Alle Stereotype werden durch die Auswertung bestätigt: Der Journalist ist unmoralisch, (zu) mächtig, kommerzialisiert, boulevardesk und ein Allerwelts-Journalist. Die formale Bildung zeigt sich als wesentliche Variable: Vor allem die Gruppe der höher Gebildeten, die “die wichtige gesellschaftliche und demokratische Funktion des Journalismus anerkennt”, wird durch die “derzeitige Performanz am meisten getroffen” (133). Das ist nicht überraschend? Für die Dresdner Forscher jedenfalls nicht, denn ihr Zwischen- (74) und Schlussfazit (127ff.) unterscheidet sich nicht vom Ausgangsszenario: Die Bevölkerung erwartet mehr vom Journalismus, als sie von ihm bekommt; sie vertraut den Journalisten nicht, hält sie für zu mächtig und auf eigene Interessen bedacht. Allerdings muss die Forschergruppe ihre Ergebnisinterpretation ein wenig relativieren, denn “die Einstellungen der Menschen zu Medien und Journalismus [sind] eher diffus, wenig strukturiert und wenig kohärent” (133). Aber nicht verzagen: “In ihrer Gesamtheit allerdings geben die Befunde dennoch ein stimmiges Bild, dass nämlich den Bürgern an den Medien vieles nicht passt.” (ebd.)
Der Forderung, die nach 136 Seiten formuliert wird, den Journalismus “zwar nicht de lege aber de facto zu einer Profession” zu machen, dies durch entsprechende Ausbildungsangebote zu fundieren und die Journalisten vor allem in den Medienunternehmen unabhängig von ökonomischen Interessen ihre Tätigkeiten ausführen zu lassen, ist uneingeschränkt zuzustimmen.
Zur intensiven Lektüre anzuempfehlen ist das Buch jenen Praktikern, die völlig vorurteilsfrei in Journalistik-Wissenschaftlern Forscher im Elfenbeinturm sehen, die keine verwertbaren, unterhaltsam zu lesenden und gerne auch provokanten Bücher zustande bringen. Alle anderen profitieren schon vom “Scannen”.
Literatur:
- Kohring, M.: Vertrauen in Journalismus. Konstanz [UVK] 2004.
- Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Frankfurt am Main [Zweitausendeins] 2005.
Links:
- Verlagsinformationen zum Buch
- Webpräsenz des Dresdner Instituts für Kommunikationswissenschaft
- Persönliche Homepage von Wolfgang Donsbach
- Webpräsenz von Beatrice Dernbach an der Hochschule Bremen
- Die Studie “Journalismus 2009” des Kölner Markt- und Organisationsforschungsinstituts YouGovPsychonomics in Kooperation mit der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (München) zeigt ebenfalls, dass Journalisten zwar ein hohes Ansehen genießen (immerhin 61 Prozent stimmen diesem Item zu), ihnen aber hinsichtlich des Wahrheitsgehalts ihrer Berichterstattung misstraut wird. ↩


[…] Wolfgang Donsbach; Mathias Rentsch; Anna-Maria Schielicke; Sandra Degen: Entzauberung eines Berufs […]