Rezensiert von Hannah Wahl
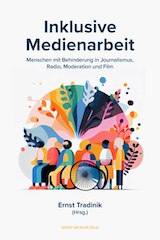

Inklusion – ein Schlagwort, das auch im medialen Kontext immer präsenter wird. Wenn zum Beispiel Österreichs größtes Charityformat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (“Licht ins Dunkel”) kritisiert wird oder aber die Massenmedien in verschiedenen Sendungsformaten ganz generell über Menschen mit Behinderungen berichten, darf das Stichwort Inklusion nicht fehlen. Das aber täuscht schnell über den Ist-Zustand hinweg, denn Inklusion ist in Österreich und Deutschland nach wie vor eine große Baustelle.
Wenn es um die Darstellung in Massenmedien geht, gilt noch immer: Menschen mit Behinderungen sind stark unterrepräsentiert. Oft bedient man sich verschiedener Stereotype (“Opfer” vs. “Helden”), anstatt ihre Lebensrealitäten abzubilden und Augenhöhe herzustellen (vgl. MediaAffairs 2016). Und nach wie vor viel zu selten sind Menschen mit Behinderungen selbst als Journalist*innen oder als Medienmacher*innen tätig. Dies trifft besonders zu auf Menschen mit Lernschwierigkeiten (im Buch bezeichnet als “Lernbehinderung”, veraltet: “Menschen mit geistiger Behinderung”) sowie Menschen mit Psychiatrieerfahrung.
Inklusive Medienarbeit kann eine wichtige Rolle dabei spielen, Veränderungsprozesse zum Positiven durchzusetzen. Durch Zugang zu Medien, durch mediale Repräsentation auf Augenhöhe und die Möglichkeit, selbst medienschaffend zu sein, wird Macht ein Stück umverteilt und gleichberechtigte Teilhabe realer. So können Menschen mit Behinderungen selbst (mit-)entscheiden, welche Themen bearbeitet werden, und haben Einfluss auf ihre Darstellung. Inklusive Medienarbeit kann einen bedeutsamen Beitrag zu Empowerment und Selbstermächtigung leisten, wie auch Ernst Tradinik verdeutlicht.
Er ist Herausgeber und “Hauptautor” des Buches Inklusive Medienarbeit. Menschen mit Behinderung in Journalismus, Radio, Moderation und Film, das 2024 im Herbert von Halem Verlag erschienen ist. Er selbst hat jahrelang als Betreuer und Sozialpädagoge gearbeitet und lässt diese Erfahrungen an vielen Stellen, zum Teil anekdotenhaft, einfließen.
Tradinik unterteilt das Buch in fünf Abschnitte. Im ersten Teil steht die Frage “Was ist Inklusive Medienarbeit?” im Zentrum. Hier werden unter anderem Teilbereiche des Arbeitsfeldes umrissen: Was können Unterstützer*innen tun, um inklusiv zu arbeiten? (“Teilhabe und Partizipation”) Welche technischen Hilfsmittel können dabei unterstützen? Teil zwei gibt “Einblicke in die Geschichte der Inklusion und der Inklusiven Medienarbeit”. Dieser Abschnitt enthält eine Sammlung sehr unterschiedlicher Texte. In einem davon schildert Cornelia Pfeiffer, eine Selbstvertreterin, das Leben in Heimen in einfacher Sprache. Erfahrungsschilderungen und biographische Erzählungen wie diese sind für inklusive Medienmacher*innen unabdingbar. Nur durch das Befassen mit diesen Thematiken (auch aus erster Hand) werden die Dimensionen der gesellschaftlichen Ausgrenzung und viele machtspezifische Aspekte deutlich. Teil vier und Teil fünf beschreiben unterschiedliche Medien(-projekte), Initiativen und Akteur*innen des inklusiven Medienbereichs. Zahlreiche QR-Codes erleichtern die Handhabe der Verlinkungen.
Positiv fällt auf, dass der Herausgeber stets auf die komplexe Machtfrage und die Notwendigkeit zu Reflexion der eigenen Position verweist. Er fordert auf zu hinterfragen, ob wirklich von Inklusion die Rede sein kann: “Wie begegne ich Menschen? Wie gehe ich tatsächlich mit Ihnen um? Dies ist einer der schwierigsten Bereiche. Weil ja natürlich alle Inklusion wollen und leben. Das wird jede/r so sagen. Dies ist auch so schwierig, weil Inklusion nicht messbar ist. Oft geht es um (un-bewusste) Machtfragen. Dennoch gilt es, sich damit zu beschäftigen, wie man dennoch einen gewissen Qualitätsstandard einhält.” (20)
An einigen Stellen bleiben Inhalte vage, wirkt das Buch unstrukturiert und sprunghaft. Tradinik definiert Inklusive Medienarbeit folgendermaßen: “Inklusive Medienarbeit meint die elektronische (Radio, Video und ähnl.) Medienarbeit von und mit Menschen mit (Lern-)Behinderung und/oder psychischer Erkrankung. Mit oder ohne Begleitung/Unterstützung von Expert*innen aus dem (sozial-)pädagogischen, kommunikationswissenschaftlichen oder ähnl. (Medien-)Bereichen.” (30) Diese sehr weitgefasste Definition bleibt beim Aspekt der Inklusion unpräzise. Sie berücksichtigt nicht, wie genau der Prozess der Inklusiven Medienarbeit (Partizipation und Machtverhältnisse) aussehen sollte – kurz: Wann ist Medienarbeit wirklich inklusiv? Obwohl das Thema Partizipation erwähnt wird, erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung erst später. Die Darstellung der Medienprojekte wirkt eher lexikalisch und enthält teilweise direkt übernommene Webseitentexte. Medienpädagogin Anja Thümmler gibt (neben anderen Autorinnen) aufschlussreiche Einblicke in die Praxis. Sie schreibt über die Medienarbeit von “Radio Inclusive” und darüber, wie man Augenhöhe überhaupt herstellt. Sie geht dabei auf zentrale Punkte und Barrieren ein, zum Beispiel “[dass] viele Interviewgäste, selbst wenn sie im Bereich ‘Inklusion’ arbeiten, keine leichte Sprache sprechen können. Sie sitzen lernbehinderten Radioredakteur*innen gegenüber, bekommen deren Frage gestellt, aber beantworten diese auf eine Art und Weise, die vom Gegenüber nicht verstanden werden kann.” (242)
Schade ist, dass den Kapiteln keine Zusammenfassungen in Leichter Sprache angehängt sind, zumal ihre Bedeutsamkeit für Menschen mit Lernschwierigkeiten im Buch immer wieder reflektiert wird. Das ist möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass sich das Buch an (potenzielle) Unterstützer*innen ohne Behinderungen richtet.
Bereichernd ist es, wie das Buch die Bedeutung von (inklusiver) Medienarbeit für institutionalisiert lebende Menschen ausarbeitet, und zeigt, welche Auswirkungen sie auf das Selbstbild und die damit verbundene Selbstermächtigung hat. Indirekt verdeutlicht Inklusive Medienarbeit auch, dass Inklusion im deutschsprachigen Medienraum längst noch nicht umgesetzt ist. Nach wie vor dominieren “inklusive Medienprojekte”. Teilhabe an der (bezahlten) Medienarbeit in etablierten Massenmedien, als Redakteur*in oder Moderator*in, ist immer noch eine Seltenheit. Hier wäre eine tiefergehende Auseinandersetzung wünschenswert gewesen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten, Menschen mit Behinderungen umfassende Teilhabe in allen Lebensbereichen zu gewähren. Sie hält fest, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sind und ein Recht auf Inklusion haben. Um dieses Verständnis zu verankern und umzusetzen, ist nicht nur der (barrierefreie) Zugang zu Medien, sondern auch zu den damit zusammenhängenden Berufen unabdingbar. Darum sind Redaktionen der etablierten Medien gefragt, sich mit Inklusiver Medienarbeit zu befassen. Inklusion geht uns alle an.
Literatur:
- Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege- und Konsumentenschutz (BMSGPK) (Hrsg.): UN-Behindertenrechtskonvention. Deutsche Übersetzung der Konvention und des Fakultativprotokolls. Online unter: https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=19
- MediaAffairs: Menschen mit Behinderungen in österreichischen Massenmedien. Jahresstudie 2015/2016, online unter: https://www.rtr.at/medien/aktuelles/publikationen/Publikationen/Studie_Menschen_mit_Behinderung.de.html
Links:
Über das BuchErnst Tradinik (Hrsg.): Inklusive Medienarbeit. Menschen mit Behinderung in Journalismus, Radio, Moderation und Film. Köln [Herbert von Halem Verlag] , 432 Seiten, 37,- EuroEmpfohlene ZitierweiseErnst Tradinik (Hrsg.): Inklusive Medienarbeit. von Wahl, Hannah in rezensionen:kommunikation:medien, 4. März 2025, abrufbar unter https://www.rkm-journal.de/archives/25375
