Rezensiert von Ute Schneider
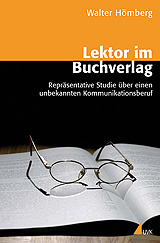

Erfassungsgrundlage waren die Mitgliedsfirmen des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, eingeschränkt auf die im Buchsegment tätigen Verlage. Schätzungsweise 2.200 bis 2.300 festangestellte Lektoren und ca. 500 freie Lektoren arbeiten in der deutschen Verlagsbranche (63f.). Hömberg hat sowohl Fragebogen an Verlage versandt zwecks Ermittlung von Unternehmensgrößen, -strukturen und Umsatz als auch an Lektoren zur Erhebung von persönlichen Daten und beruflichen Aussagen. Über diese quantitativ angelegte Befragung hinaus wurden auch qualitative Interviews mit 16 Lektoren in den Verlagszentren Berlin, München, Frankfurt am Main und Stuttgart geführt. Die Fragebogen und die methodische Vorgehensweise sind im Anhang der Studie penibel und nachvollziehbar dokumentiert.
Hömberg beginnt seine Studie mit einem Blick auf die aktuelle Situation und Struktur der Verlagsbranche. Eingebettet in den Kontext allgemeiner Buchmarkttrends wie Filialisierung des Sortiments, elektronisches Publizieren und anderer branchenrelevanter Entwicklungen wird das Lektorat in der Organisationsstruktur eines Verlags positioniert. Es folgen dann die Auswertungen der Lektorenbefragungen, wobei sozialer Status ebenso wie der Berufsalltag mit den spezifischen Aufgabengebieten, das Selbstverständnis der Befragten, ihre Ausbildung und ihre Berufszufriedenheit ermittelt wurden. Auch das Verhältnis zu den Autoren wird eigens beleuchtet und schließlich ein Blick auf die Zukunft des Berufs geworfen.
Was lässt sich nun über den typischen Lektor bzw. die Lektorin sagen? Ein paar Schlaglichter: Der ungeregelte Berufszugang eröffnet auch heute noch Quereinsteigern die Möglichkeit, Verlagslektor zu werden; immerhin 55 Prozent der Befragten haben vorher in anderen Berufen, meist in der Medienbranche, gearbeitet (205). Ein hohes formales Bildungsniveau scheint eine – wenn auch nicht explizit geforderte – gängige Voraussetzung zu sein, 70 Prozent haben ein abgeschlossenes Studium (hier dominieren die einschlägigen Geisteswissenschaften), jeder Fünfte ist promoviert (206). Soweit keine Überraschung. Erstaunlich aber doch, dass die klassischen Aufgaben des Lektors, nämlich Autorenbetreuung, Arbeit am Manuskript, das Verfassen von Informationstexten und die Prüfung eingelangter Manuskripte die ersten Plätze im Arbeitsalltag einnehmen. Das passt kaum zum Produktmanager, der sich in erster Linie organisatorischen Dingen widmen muss, was dann prozentual auch direkt auf die klassischen Funktionen folgt (207).
Die Ergebnisse der Studie zeigen eine aktuelle Verfestigung von manch historisch Gewachsenem: das Einkommen ist traditionell niedrig (durchschnittliches Nettoeinkommen: 2000 Euro), das zeitliche Arbeitspensum dagegen recht hoch (gut 45 Stunden/Woche); die Karrieremöglichkeiten wiederum sind eher unbefriedigend und die Weiterbildungsmöglichkeiten eher gering (207/208). Diese Tatsachen haben ebenso Tradition wie der Wunsch der Befragten, dem Verlag und gleichzeitig den Autoren zu dienen sowie Bildung und Aufklärung zu verbreiten. Interessant und aufschlussreich sind auch die in der Studie wiedergegebenen O-Töne der Lektorinnen und Lektoren. Da freut es bei der Frage nach der Berufswahl zu lesen: “Irgendwie hat sich da eben doch mein ursprünglicher Traum erfüllt. Ich finde es faszinierend, wie Gedanken und Phantasien und Weltbilder einen konkreten, anfassbaren Ausdruck finden können zwischen zwei Buchdeckeln.” (Dietrich Voorgang, 122)
Hömbergs Studie ist verdienstvoll, kann sie doch durch den Blick auf die konkrete Ausgestaltung des Berufsalltags die diffusen Vorstellungen vom Lektorenberuf klären, und darüber hinaus liefert sie nebenbei eine Bestandsaufnahme der Buchbranche. Wünschenswert wäre eine Wiederholung der Analyse nach 10 oder 15 Jahren, um Wandlungen und Konstanten ablesen zu können. Was passiert mit dem Lektor zum Beispiel angesichts der Durchsetzung des E-Books? Denn auch das ist in der Studie deutlich geworden: das elektronische Publizieren hat erheblich weniger Einfluss auf die Lektorenposition und damit auf die Verlagsorganisation als immer gerne behauptet wird.
Links:
- Verlagsinformationen zum Buch
- Webpräsenz von Walter Hömberg an der Universität Eichstätt
- Webpräsenz von Ute Schneider an Universität Mainz

